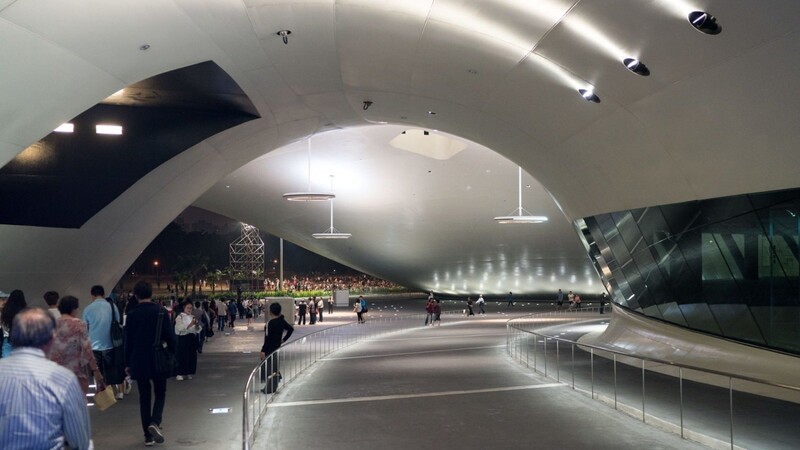Kultur
Glanz und Routine
7. Februar 2023, 17:00 Uhr aktualisiert am 7. Februar 2023, 17:00 Uhr

Das Nationaltheater als Konzertsaal
Vor fast 30 Jahren dirigierte Zubin Mehta Bruckners Achte im Nationaltheater. Zusammen mit dem "Tannhäuser" von 1994 führte dieses Konzert zu seinem Vertrag als Generalmusikdirektor. Es war eine dichte, dramatische Aufführung, weit entfernt von der damals in München maßgeblichen Sichtweise Sergiu Celibidaches bei den Münchner Philharmonikern.
Heute erinnert Mehta unweigerlich selbst an Celibidache, wenn er sich mit Stock und zurückgekämmten Haaren langsam seinem Stuhl vor dem Bayerischen Staatsorchester nähert. Mehtas Sicht auf Bruckner hat sich kaum verändert. Auch die Siebte des 86-Jährigen ist dem Leben zugewandter als den ewigen Dingen, manches gerät geradezu kulinarisch, was dem warmen und vollen Klang des Orchesters entgegenkommt.
Das wird besonders auffällig am Ende des langsamen Satzes. Der Tubenchoral, eine Trauermusik auf Richard Wagner, erscheint bei Mehta weniger düster als sonst. Die Stelle erinnert verblüffend an das Vorspiel zum dritten Akt der "Meistersinger" und verweist daher eher voraus auf den strahlenden Schluss. Und das wirkt auch dramaturgisch stimmig, als Scharnier zwischen den Sätzen und als Vorahnung des Finales.
Mehta gelang das bei dieser Symphonie schwierige Kunststück, auch im Scherzo und im Finale der Bruckner-Symphonie die Spannung aufrechtzuerhalten: mit vitaler und bisweilen sehr bewusst das Brutale streifender Kraft und einem untrüglichen Sinn für das nicht zu rasche, aber auch nicht zu langsame Tempo.
Auch wenn am ersten Abend die allerletzte Steigerung etwas stumpf strahlte und auch sonst hin und wieder Wackler nicht ausblieben: Mehta und dem Staatsorchester gelang eine glühende Aufführung, die sich des 500-jährigen Orchesterjubiläums würdig erwies, zu dessen Feier in dieser und der kommenden Saison alle noch lebenden Generalmusikdirektoren als Gäste zurückkehren.
Das Vorprogramm beglückte nicht in vergleichbarer Weise. Die Uraufführung "Apollon und Dionysos" von Minas Borboudakis wirkte bei aller rhythmischen Verve doppelt und dreifach mit Klavier- und Schlagzeuggeglitzer überzuckert. Dem philosophischen Gegensatz wurde die in ihren Kontrasten eher unterwickelte Musik kaum gerecht, Dass es sich im solide, dem Anlass und den Interpreten gemäße Gebrauchsmoderne handelt, soll nicht bestritten werden.
Wer die klassisch-kühle Deutung durch den Dirigenten Herbert Blomstedt und den Geiger Leonidas Kavakos vor drei Wochen mit dem BR-Symphonieorchester noch im Ohr hatte, den irritierte das herbstmilde Abendlicht, das Mehta und die Geigerin Vilde Frang über Felix Mendelssohn Bartholdys Violinkonzert tauchten. Die Geigerin spielt zwar gesanglich und schön, doch um den Preis kurzatmiger Phrasierungen und eines alle Melodien verzitternden Dauer-Vibratos - etwa im Übergang vom Allegretto zum Finale. Mendelssohn braucht aber keine altmodischen Spitzendeckchen, er ist auch kein mittlerer Brahms. Er sollte hell leuchten. Das überließ Mehta an diesem Abend Bruckner, und zwar so, dass man sich noch lange daran erinnern wird. Und darauf kommt es an.